Plädoyer für eine gewisse Anormalität
Die „klassischen Neurosen“ der „normalen Neurotiker“ werden immer seltener. In den Behandlungszimmern der Psychoanalytiker stellen sich heute meist Patienten ein, die keine ausgeprägten hysterischen oder Zwangssymptome haben, sondern sich über diffuse Gefühle von Angst und Depression beklagen, über wiederholtes Versagen oder andere Symptomformen wie Süchte oder psychosomatische Krankheiten. Während die Analysanden früher meist an neurotischen Sexualproblemen litten („Ich liebe sie, aber ich kann nicht mit ihr schlafen“), treten heute Symptome in den Vordergrund, die sich aus älteren Konflikten der psychischen Entwicklung eines Individuums ergeben („Ich schlafe mit ihr, aber kann sie nicht mehr lieben“). Es handelt sich dabei um Probleme, die nicht in erster Linie mit der sexuellen Identität, sondern mit dem archaischeren Dilemma der subjektiven Identität zu tun haben.
Verhältnismässig spät tritt ja in der Entwicklung des Kindes der kleine Ödipus zutage, der die Tatsache des Geschlechtsunterschieds, die narzisstische Kränkung durch die Urszene und die Versagung seiner erotischen und aggressiven Wünsche gegenüber den Eltern bewältigen muss. Sehr viel früher hat man es mit einem kleinen Narziss zu tun, der mit dem definitiven Verlust der Brust-Mutter fertig zu werden hat und dem sich die unabweisbare Notwendigkeit stellt, durch die Schaffung innerer psychischer Objekte diesen Verlust zu kompensieren.
Wenn dies angesichts überwältigender psychischer Traumata in der frühesten Kindheit misslingt, bleibt die subjektive Identität durch archaische Trennungs-, Desintegrations- und Todesängste bedroht. Sexuelle Perversionen, Homosexualität, narzisstische und psychosomatische Störungen oder „Überanpassung an die Realität“ können als die individuell verschiedenen und insofern durchaus „schöpferischen“ Leistungen des Subjekts verstanden werden, solche Dilemmata zu lösen.
Die Abwehrmechanismen der Patienten, auf deren klinisch dokumentiertem Material sich die vorliegenden Untersuchungen von Joyce McDougall stützen, reichen also tiefer als die Verneinungen und Verdrängungen der neurotischen Kastrationsangst; sie entsprechen vielmehr dem, was Freud als Verwerfung und Lacan als forclusion bezeichnet haben.
Insbesondere bei jenem Patiententyp, den die Autorin als „Anti-Analysanden“ beschreibt, konnte die durch die traumatische Abwesenheit des Anderen entstandene Lücke in der symbolischen Kette weder durch psychische Objekte (als Keime einer „normalen“ Ich-Identität) noch durch später verdrängte Phantasien (neurotische Lösungen), noch durch Schaffung eines Wahnsystems (psychotische Lösung) ausgefüllt werden. Statt dessen konstruieren solche Patienten eine undurchdringliche Mauer um sich herum, um jene ursprüngliche Spaltung zu verdecken, auf der die menschliche Subjektivität gründet. Das Leiden des Subjekts äussert sich hier in der Unfähigkeit zu leiden; das Ich besitzt die trügerische Stärke eines Roboters – und bezahlt dafür mit seinem psychischen Tod. Bei solchen „Anti-Analysanden“ stösst die Psychologin auf die Grenzen ihrer Anwendbarkeit – was umgekehrt den Analytiker in seinem Selbstverständnis ernsthaft bedroht.


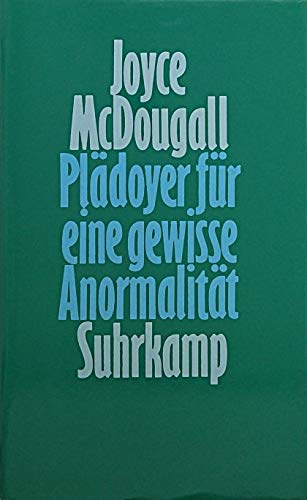
 Verfügbar
Verfügbar