Psychoanalyse in wissenschaftstheoretischer Sicht
Zum Werk Sigmund Freuds und seiner Rezeption
Adolf Grünbaum., Professor für Philosophie und Psychiatrie an der Universität von Pittsburgh, setzt sich mit psychoanalytischen Theorien und Hypothesen auseinander, die sich den Arbeiten von Freud angeschlossen haben oder auf ihnen beruhen. Grünbaum kommt zu dem Ergebnis, Dass die von Jürgen Habermas und Paul Ricoeur aufgestellten hermeneutischen Rekonstruktionen der psychoanalytischen Theorie und Therapie im wesentlichen unzutreffend sind. Der Autor widerlegt ausführlich den Vorwurf des „Szientismus“, den Habermas und Ricoeur Freud gegenüber erhoben haben, und stellt die Behauptung auf, dass sie mit ihren ontologischen, epistemologischen und semantischen Thesen dem psychoanalytischen Vermächtnis eine philosophisch fremde Ideologie aufgebürdet haben.
Im weiteren werden die Argumente überprüft, die Freud selbst für seine Theorie der Verdränung (psychischer Konflikt) und für deren Therapie anführte. Dabei stehen seine Ätiologien der Psychoneurosen, seine Erklärung von Fehlleistungen und seine Theorie der Traumbildung im Vordergrund. Als Schwerpunkt stellt sich heraus, dass die retrospektive klinische Methode der psychoanalytischen Untersuchung mittels >freier Assoziation< nicht dazu geeignet ist, den Nachweis zu erbringen, dass verdrängte Vorstellungen Psychopathologien verursachen und dass diese unsere Träume und unsere Fehlleistungen bewirken. Die Lehre, die sich daraus ziehen lässt, ist, dass die klinische Evidenz, auf die beinahe alle Freudianer und Neo-Freudianer in Vergangenheit und Gegenwart gleichermassen ihre Haupthypothesen begründet haben, das psychoanalytische Gebäude nicht stützt. Wenn es eine Bestägigung dafür gibt, so wird der erforderliche Nachweis wahrscheinlich in der Hauptsache von epidemiologischen oder experimentellen Untersuchungen und von vergleichenden Studien der Behandlungsergebnisse kommen.


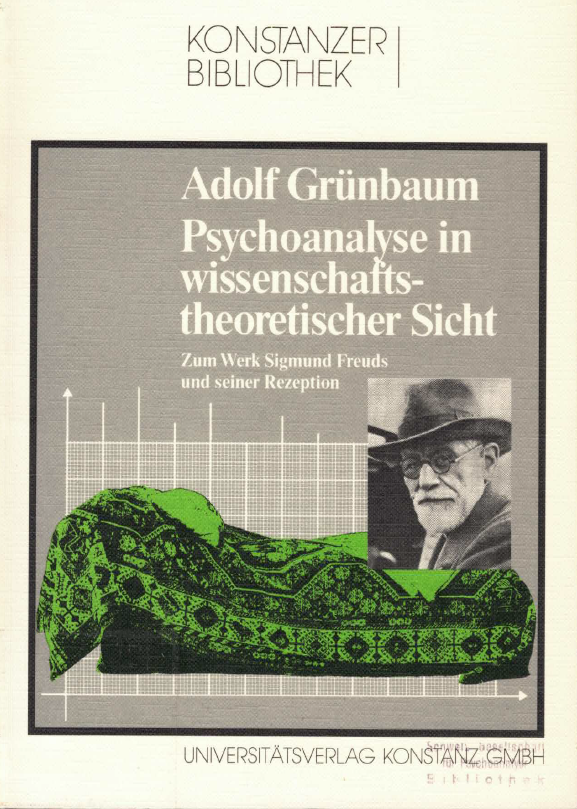
 Verfügbar
Verfügbar