Der Krieg und seine psychosozialen Funktionen
Seit Europa wieder aktiv in Kriege verstrickt ist, erleben auch jüngere Generationen, dass Gewalt zwischen Staaten nicht exotisch ist. Kriege haben nicht nur in aussergewöhnlichen historischen Situationen stattgefunden, angezettelt von besonders machtlüsternen und blutdürstigen Staatsführern; schon gar nicht sie sie „ausgebrochen“ wie eine Krankheit oder eine gefangene Bestie. Kriege werden gemacht, und um gemacht zu werden, müssen sie gewünscht sein. Der menschliche Aggressionstrieb, der vielfach gerade aus psychoanalytischer Sicht als Movens zum Krieg begriffen wurde, vermag Massaker, Exzesse, „Heldentum“ zu erklären, kann aber, wie Stavros Mentzos zeigt, nicht der auslösende Impuls für die Entfesselung von Kriegen sein. Vielmehr werden kriegerische Auseinandersetzungen gebraucht, um narzisstische Bedürfnisse und Defizite zu kompensieren. Indem innere Konflikte, Identitätskrisen, Depressionen, Sinnlosigkeitsgefühle nach aussen verlagert werden, finden sie auf einem Schlachtfeld den Schauplatz, auf dem sie übertönt werden. Kriegsprävention kann erfolgreicher sein, wenn diese Zusammenhänge verstanden werden.


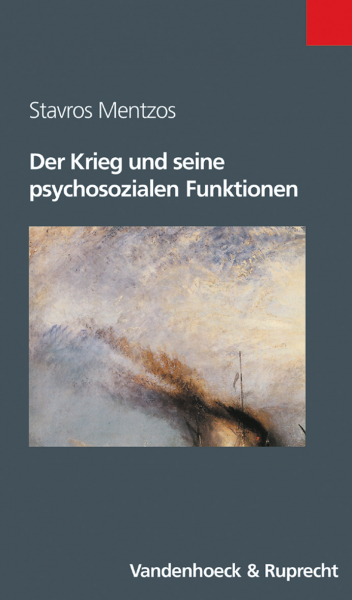
 Verfügbar
Verfügbar